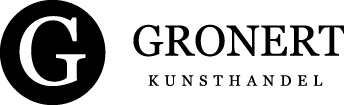Beschreibung
Prunkteller mit seltener Ansicht der Kolonnaden von Schloß Sanssouci in ländlicher Idylle
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin 1815
Modell Antikglatt (Speiseteller, flach, Größe 3)
Modell-/Taxnummer 1054/1,1504
Durchmesser 24,2 cm
Marken Zepter in Unterglasurblau; 121. In Aufglasurgold; Pressmarke c; Ritzmarke III
Ex Twinight Collection New York (Inv. Nr. B-169)
Dokumentation
Der hier vorgestellte Teller geht auf eine Bestellung zurück, die im Bestellbuch der Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin am 12. September 1815 verzeichnet wurde. Hier wird genau ausgeführt: Teller, antikglatt: mit bister Prospekt von Sans-souci vo[n] der Feldseite aus der Ferne im zugemalten Spiegel darum Gold erh. Arabesq: mit dahinter pol. Fond auf den bord Gold Arabesque mit grünen Spitzen dahinter Goldrand.[1]
Der Originalentwurf zu der kreisrunden Zentralansicht hat sich als Federzeichnung im KPM-Archiv erhalten. Sie misst 15 cm im Durchmesser, ist weder datiert noch signiert und trägt die Bezeichnung Die Colonnade von Sans-souci bei Potsdam mit der Zusatzchiffre W 130.[2]
Ansicht
Diese Darstellung der, wie Sanssouci selbst auch von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff entworfenen Kolonnaden in der ländlichen Umgebung von Bornstedt ist ungewöhnlich und auf keinem weiteren bekannten Porzellan der KPM zu finden.
Eva Wollschläger beschreibt die Ansicht im Spiegel dieses Tellers wie folgt: Dargestellt ist der Blick von Norden auf die Kolonnaden von Schloss Sanssouci, welche als Schmuckelemente die Auffahrt zum Ehrenhof des Schlosses säumen. Das als Sommerresidenz für Friedrich den Großen erbaute Weinbergschlöschen ist als eingeschossiger Bau hinter den sich im halbrund öffnenden Kolonnaden nur zu erahnen. Diese wenig repräsentative Ansicht des berühmten Lustschlosses von Potsdam veranschaulicht die ursprüngliche Konzeption des Bauwerks als idyllisches, außerhalb der Stadttore gelegenes Refugium des Königs. Ausdruck des ländlichen Charakters der Anlage ist die rechts neben dem Schloss aufragende Mühle, die heute noch als Wahrzeichen von Sanssouci gilt. Bereichert durch einzelne, im Vordergrund lustwandelnde Staffagefiguren ist die feine, gestrichelte Federzeichnung sehr geschickt in die Technik der Porzellanmalerei übertragen worden, die zusammen mit ihrem aufwendig gearbeiteten Randdekor den Eindruck einer kostbar gerahmten Graphik erwecken möchte. In der Art der Komposition und der Genauigkeit der Darstellung erinnert die Ansicht an Sepia- oder Federzeichnungen von Samuel Rösel, der als freier Landschaftskünstler auch Vedutenvorlagen für die KPM geschaffen hat.[3]
Wohl etwa zur selben Zeit schuf der bekannte KPM-Maler Johann Hubert Anton Forst (1756-1823) eine Ansicht der Kolonnaden vom Nordwesten aus, die als kolorierte Radierung des Dresdener Künstlers Friedrich August Schmidt im Berliner Verlag des Johann Baptist Weiss Verbreitung fand.[4]
Ornamentik und Dekor
Die prächtige Gestaltung der die Zentralansicht rahmenden Randzonen zeigt einige Besonderheiten der zu Beginn des 19. Jahrhunderts vom KPM-Malereicorps verwendeten Malereitechniken. Der äußerste Rand mit seinen auf Glanzgold rapportierenden, durch erhabene Pünktchen als Kette verbundenen, leicht schattierten Ovalen mit achtfach stilisierten Blüten gibt dem Teller seinen prunkvollen Rahmen. Es folgt eine dünne braune Linie, der sich ein Band aus Rechtecken mit graviertem Stricheldekor aus Glanz- und Poliergold anschließt. Ein ebenso gestaltetes, gleich breites Band umrahmt auch die Vedute im Spiegel. Dazwischen hat der Entwerfer eine breite Zone gelegt, die in ihrer Mitte vom Grat des Telleranstiegs geteilt wird. In ihr ist eine Ornamentik aus stilisierten liegenden Blüten- und Akanthusblättern angeordnet, deren zwischen hell und dunkel changierende grünliche Farbgebung mit ihrer schwarzen Schattierung den Eindruck eines tief geschnittenen Steinfrieses vermittelt.
Die im Bestellbuch gebrauchte Bezeichnung bister für die monochrome Farbgestaltung der seltenen Potsdam-Vedute geht auf den französischen Begriff bistre für nuss- oder schokoladenbraun zurück. Die aus Holzruß gewonnene Tintenform oder Wasserfarbe Bister wurde speziell vom 15. bis ins 18. Jahrhundert für Feder-, Pinsel- oder Kohlezeichnungen verwendet – u.a. von Künstlern wie Leonardo da Vinci, Rembrandt, Claude Lorrain, Tintoretto oder Tizian –, ehe sie im Laufe der Zeit vom Farbstoff Sepia (abgeleitet vom Tintenbeutel der Sepien = Tintenfische) abgelöst wurde.
[1] Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, KPM-Archiv (Land Berlin), B Buch 1813–1820, Eintrag vom 12. September 1815, 263, zitiert nach: Eva Wollschläger, Teller mit Ansicht der Kolonnaden von Schloss Sanssouci, in: Samuel Wittwer, Raffinesse und Eleganz – Königliche Porzellane des frühen 19. Jahrhunderts aus der Twinight Collection New York, München 2007, 320.
[2] Abb. ebenda (KPM-Archiv, Inv. Nr. Z 8; Mappe 24a, Blatt 20).
[3] Ebenda.
[4] Vgl. https://nat.museum-digital.de/object/166743, abgerufen am 11. September 2024. Aus der Sammlung des Potsdam Museums, Inventarnummer: 66-54-K2b.