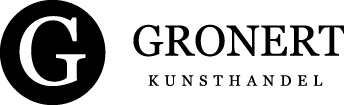Beschreibung
Adolph Flad, Vase Kakadus, KPM Berlin 1922
Modell Chinesisches Blumengefäß mit ausgeschnittenen Rand
Modellentwurf KPM-Werkstatt; Modellbucheintrag 1865
Modellnummer 2240 / Taxnummer 5,39
Dekornummer 147/516: Schwarze Kakadus mit grau-schwarzen Ornamenten und gold-grünem Gitterwerk
Dekor- und Ornamentikentwurf Adolph Flad 1922
Höhe 60,5 cm
Marken Zepter in Unterglasurblau; Reichsapfel über KPM in Aufglasurrot; Pressmarken Jahresbuchstabe N für 1913 (Weißporzellan)
VASE:
Die imposante Vase entstand anläßlich der Deutschen Gewerbeschau, der ersten großen Leistungsschau der Deutschen Kunst nach dem Weltkrieg, die vom 13. Mai bis zum 8. Oktober 1922 im Ausstellungspark auf der Theresienhöhe in München stattfand. Hier wurde das über 60 cm hohe Prunkstück im vom Münchener Architekten Paul Ludwig Troost konzipierten Ausstellungsraum der kurz zuvor in Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin umbenannten KPM erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.[1]
Die in Flads typischem expressiv-stilisierten Malereistil dekorierten Vasen gehörten zu den progressivsten KPM-Porzellanen, die die Manufaktur in München vorstellte. Weitere moderne Porzellanplastiken und -dekore stammten von Paul Scheurich, Anton Puchegger, Joseph Wackerle, Adolph Amberg, Theodor Schmuz-Baudiss, Hermann Hubatsch, Edmund Otto, Harry Christlieb, Julius Feldtmann und Gertrud Kant.
DEKOR:
Adolph Flads drei Originalentwürfe des Malereidekors für diese im KPM-Modellbuch als Chinesisches Blumengefäß mit ausgeschnittenen Rand 1865 erstmals erwähnte Vase aus dem Jahr 1922 befinden sich heute im KPM-Archiv des Landes Berlin (Z 139.184–186). Im Dekorbuch der Manufaktur ist unter der Taxnummer 147/516 zu lesen: Große Vase m/[it] schwarzen Papageien.
Vögel gehörten zu einem der bevorzugten Sujets des langjährigen KPM-Entwerfers Adolph Flad (1881–1937), der 1895 als 14jähriger seine Lehre in der KPM begann und bereits ab 1900 eigene Dekorentwürfe für Einzeltassen und Serviceteile in Emaillemalerei lieferte. Unter dem künstlerischen Leiter Theodor Schmuz-Baudiss gestaltete Flad ab 1907 zunehmend seine typischen Dekore mit abstrakt-geometrische Formen, die mit reicher Goldmalerei, stilisierten Naturformen, starkfarbigen Blütenmustern und in der Fläche ausgebreiteten Ornamentdekoren verbunden werden.[2] Bereits in den ersten derartigen Schöpfungen des Künstlers finden sich, neben den von ihm selbst erdachten Schmuckelementen, Darstellungen von meist deutschen Vögeln.
Ein Höhepunkt in Flads bisherigen Schaffen war eine 80 cm hohe Deckelvase mit Fasanenpaaren, die 1914 zum ersten Mal in der KPM gefertigt wurde (siehe Foto). Nach dem Weltkrieg änderte sich seine Formsprache in Richtung weiterer Stilisierung und Expressivität in der Art des Zacken- oder Kaktusstils der Zeit um 1920. Auf der Höhe seines Schaffens gelang Adolph Flad 1922 mit Dekor und Ornament der hier gezeigten Prunkvase ein zeittypisches Kunstwerk in Porzellan:
Seine realistischen und doch durch ihre dunkelschattierte Camaieumalerei mystisch anmutenden Darstellungen der beiden Rabenkakadus auf Vorder- und Rückseite kontrastieren mit dem weißen Porzellankörper und dem gold-grünen Gitter- und Rankenwerk, dem noch Reminiszenzen an die Blütezeit der europäischen Porzellankunst im Rokoko anhaften. Die stark stilisierte schwarz-graue Schuppen- und Blütenornamentik an Hals und Fuß der Vase erinnern an zeitgenössische Schwarzlotmalereien des 1918 gefallenen Glaskünstlers Karl Massanetz aus Steinschönau, der auf der Kölner Werkbundausstellung 1914 große Erfolge gefeiert hatte.
Durch die Wahl der exotischen, eigentlich in Australien beheimateten Vögel gelang Adolph Flad, der zuvor fast immer Darstellungen einheimischer Tiere auf den von ihm entworfenen Objekte abbildete, ein frühes Meisterwerk des aufkommenden Art Deko an der Berliner Porzellanmanufaktur. Dekor und Ornamentik zeigen eine stilistische Weiterentwicklung einer im April 1911 bei der KPM editierten Vase desselben Modells, die Flads Zeitgenosse Lorenz Lang mit aufwändiger, kleinteiliger Emaildekoration von spätjugendstilig stilisierten Floralmotiven um vier sich jeweils einmal wiederholenden Kartuschen mit farbigen Papageienpaaren gestaltet hatte.[3] Flads Entwurf von 1922 wirkt insgesamt freier, der Schwarz-Weiß-Grau-Kontrast zwischen Porzellanscherben und zentraler Vogeldarstellung unterstreicht eine flächige Betonung, die ganz den expressiven Strömungen der Zeit der 1920er Jahre in bildender Kunst, Theater, Film und Gebrauchsgraphik entspricht.
[1] Einzelabbildung in: Die Deutschen Gewerbeschau in München – Keramik und Glas, in: Dekorative Kunst 25 (1922), Ausgabe vom 11. August, 258 (siehe Foto).
[2] Eva Wollschläger, »… das Sinnliche des Porzellans modern empfinden«. Lust auf Dekor–Lust auf Moderne. Dekorarten und Dekorspezialisten der KPM in der Ära Theodor Schmuz-Baudiß, in: Ausst.Kat. Lust auf Dekor–KPM-Porzellane zwischen Jugendstil und Art Deco, Tobias Hoffmann und Claudia Kanowski (Hrsg.), Berlin 2013, 97, zitiert nach Tim D. Gronert, Porzellan der KPM Berlin 1918–1988, Band 3, 108.
[3] Abb. in: Tim D. Gronert, Porzellan der KPM 1918–1988, Band 1, 55.